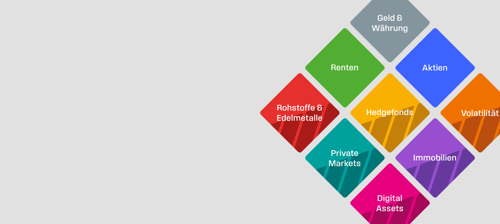Economics Update November 2025 - 2026: Schwächere globale Wachstumsdynamik, aber kein Einbruch

- Negative Auswirkungen der Zölle werden mit der Zeit spürbarer
- Zinssenkungen der Notenbanken, fiskalpolitische Impulse und hohe KI-Investitionen sind Positivfaktoren
- Schwellenländer könnten zum Ausgangspunkt eines neuen globalen Aufschwungs werden
Die Weltwirtschaft hat sich im Jahr 2025 robuster gezeigt, als es nach dem Zollschock vom „Liberation Day“ am 2. April zu erwarten gewesen wäre. Auch wenn das Zollregime nicht so umgesetzt wurde, wie von US-Präsident Donald Trump auf den Tafeln im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington angekündigt: Der durchschnittliche Importzoll der USA ist von weniger als 3 Prozent auf deutlich mehr als 10 Prozent gestiegen. Die anhand der Handelstheorie zu erwartenden Effekte einer solchen drastischen Zollerhöhung dürften nun mit der Zeit stärker spürbar werden und die globale Wachstumsdynamik im Jahr 2026 belasten. Zu rechnen ist mit steigenden Importpreisen in den USA, Druck auf den Preisen ausländischer Exporteure, einer Verringerung des realen Handelsvolumens und schließlich weltweiten Realeinkommensverlusten.
Unserer Ansicht nach wird es trotzdem nicht zu einer globalen Rezession kommen, weil es eine Reihe konjunkturstützender Faktoren gibt: In den meisten Ländern ist die Inflation unter Kontrolle und befindet sich im Zielbereich der Notenbanken. Dies eröffnet Spielräume für eine expansiver ausgerichtete Geldpolitik. Von der Fiskalpolitik dürften vielfach ebenfalls positive Impulse ausgehen, auch wenn die insgesamt sehr hohe (staatliche) Verschuldung Anlass zur Sorge gibt. Stützend wirken auch die anhaltend hohen und sogar weiter steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), die in den USA bereits im Jahr 2025 spürbar zur Beibehaltung solider Wachstumsraten beigetragen haben – und die insbesondere dort ein wesentlicher Treiber des Investitionswachstums bleiben.
Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage in den Vereinigten Staaten wird außerdem von den im ersten Halbjahr zu erwartenden Steuererstattungen für die US-Bürger im Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar angetrieben. Diese wirken außerdem der Abkühlung des Arbeitsmarktes entgegen. Risiken gehen hingegen von der Inflationsentwicklung aus. Die Chancen, dass sich die Inflation von selbst dem Zielwert der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) von 2 Prozent nähert, sehen wir im Umfeld einer stabilen Konjunktur als begrenzt an. Viel wird davon abhängen, wie die Fed mit diesem Umfeld umgeht: Gestaltet sie ihre Geldpolitik restriktiver als erwartet, könnten sich dämpfende Effekte auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ergeben.
Europa könnte weiter abgehängt werden
In Europa sind der Rückgang der Inflation auf 2 Prozent und die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ein neutrales Zinsniveau positive Faktoren. Höhere Ausgaben für die Verteidigung und für Infrastrukturmaßnahmen wirken ebenfalls positiv. Ein nachhaltiger Aufschwung erfordert allerdings weiterhin eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Wirtschaftspolitik, von der bislang kaum etwas zu sehen ist. Es besteht deshalb das Risiko, dass Europa im globalen Wettbewerb weiter abgehängt wird und das Potenzialwachstum gering bleibt.
In China ist die schwere Immobilienmarktkrise noch immer nicht überwunden, die erhoffte stärkere fiskalpolitische Stimulierung der Inlandsnachfrage bleibt auch nach der jüngsten Plenumssitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei unsicher. Eine im Vergleich zu 2025 geringere Wachstumsdynamik ist deshalb das wahrscheinlichste Szenario für das Jahr 2026.
Die Schwellenländer leiden zwar unter den Folgen der Trumpschen Zollpolitik und der Nachfrageschwäche Chinas. Die in den meisten aufstrebenden Volkswirtschaften moderate Inflation sowie stabile Währungen bieten aber weiterhin erheblichen Spielraum für Zinssenkungen der Notenbanken. Wir bewerten die deutliche Verbesserung der Finanzierungsbedingungen positiv und sehen hier die Möglichkeit, dass sich ein neuer konjunktureller Aufschwung herausbildet.
Insgesamt wird die Weltwirtschaft im Jahr 2026 unserer Einschätzung nach um 2,5 Prozent wachsen, das wären 0,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr 2025. Ein deutlicher Einbruch ist also nicht unser Basisszenario.

Head of Economics & Chief Economist

Managing Director Corporate Communications

Senior Manager Press and Multi-Channel Communications